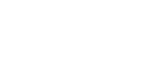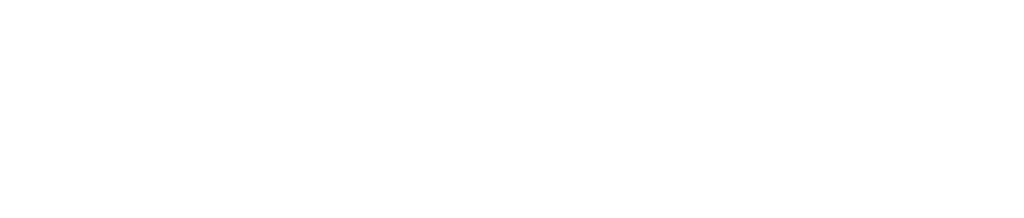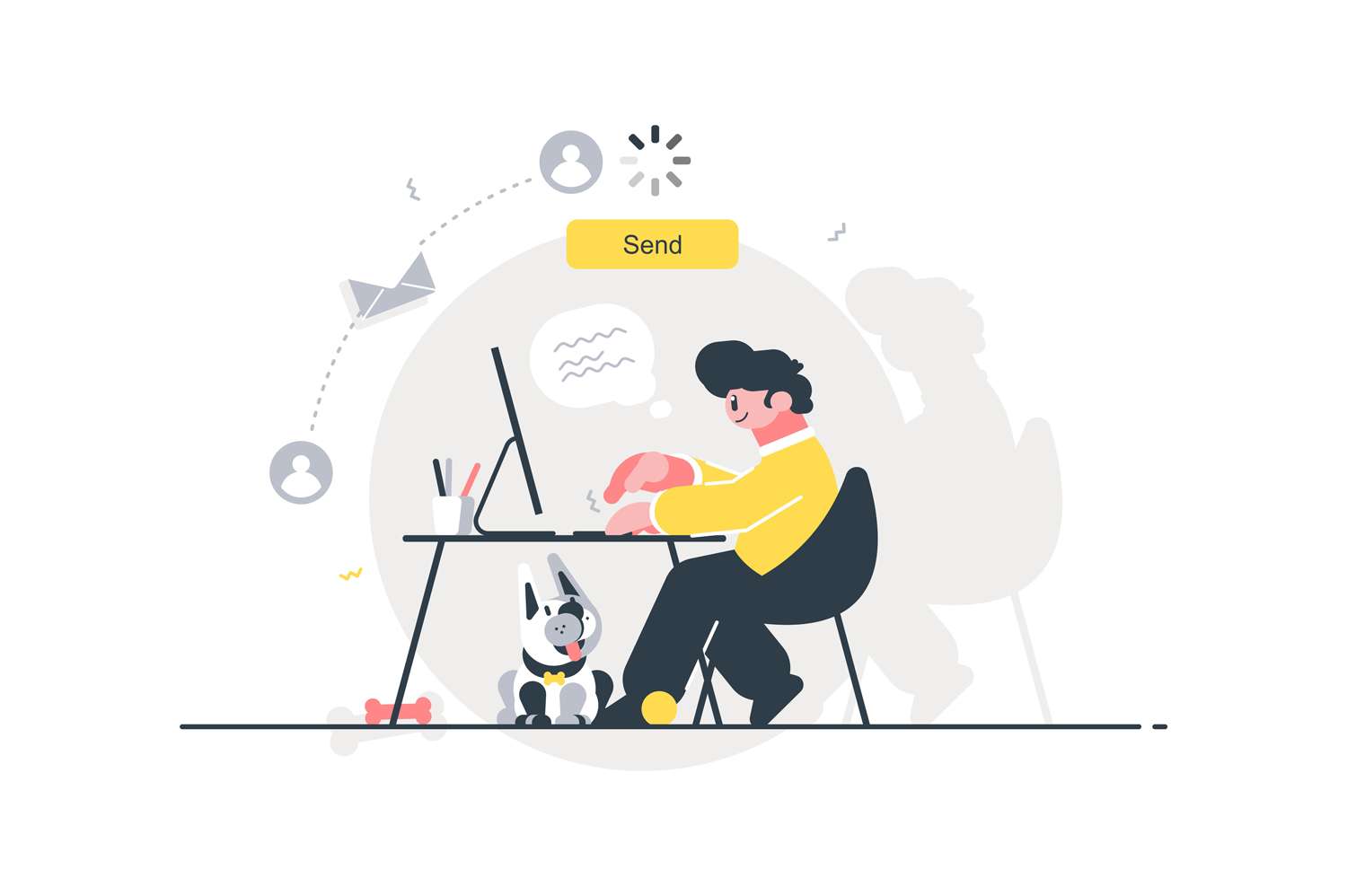Verdammt? Dogmatische Differenzen und kirchliche Koinonia
Ökumenischer Sommerkurs in Rom für Studierende der Evangelischen Theologie 11.-19. September 2024
Zum News-Blog >>Blick über den Tellerrand
Am 20. März 2024 fanden an der Evangelischen Hochschule Darmstadt spannende Impulsreferate und Diskussionen statt. In unserem News-Blog haben wir den Tag zusammengefasst.
Zum News-Blog >>Schnupperstudium für (Noch-)Nicht-Studierende
Am 21. Juni 2024 öffnet die Philipps-Universität Marburg
ihre Türen für einen besonderen Tag, an dem du das Fach "Evangelische Theologie" hautnah erleben kannst.
Weitere Informationen >>ihre Türen für einen besonderen Tag, an dem du das Fach "Evangelische Theologie" hautnah erleben kannst.
Bewältigung von Stress – Ein Wochenende für Studierende
Wie können wir trotz Stress resilienter werden? Wir laden herzlich Studierende der Theologie und Gemeindepädagogik zu einem Seminar ein, um Strategien zur Bewältigung von Stress zu erlernen.
Weitere Informationen >>Einladung zum Studierendenwochenende der EKHN
Liebe Studierende, seid herzlich eingeladen zum Studierendenwochenende der EKHN! Vernetzt euch, knüpft neue Freundschaften und lernt gemeinsam dazu.
Weitere Informationen >>SoSe 2024 Hybride Sprachkurse des Studienhauses EKKW
Vertiefe deine Kenntnisse in Hebräisch und Griechisch, egal wo du bist. Sei dabei und bereite dich optimal auf deine Prüfungen vor!
Weitere Informationen >>
Previous slide
Next slide
MachDochWasDuGlaubst – eine Ausbildung, einen Beruf oder einen Quereinstieg in der Evangelischen Kirche Hessen Nassau
Du suchst eine interessante Ausbildung und ein Berufsfeld, das dir Spaß macht und dich deinem Glauben näher bringt? Du willst mit Menschen zusammen arbeiten und deine Kreativität auch im Beruf ausleben? Dann ist die Evangelische Kirche Hessen Nassau ein interessanter und attraktiver Arbeitgeber für Dich! Für unsere vielfältigen Aufgaben in Kirchengemeinden und sozialen Einrichtungen, in der Kirchenverwaltung und in Schulen suchen wir junge Leute, die Lust darauf haben, die Zukunft der evangelischen Kirche mitzugestalten.

Pfarrer*in
Verwurzelt im Glauben, verbunden im Alltag: Begleiter in allen Lebenslagen

Gemeindepädagog*in
Nah bei den Menschen das Evangelium für Menschen erfahrbar machen

Erzieher*in
Kinder in ihrer Entwicklung
begleiten und fördern

Religionslehrer*in
Das Christentum, andere Religionen und die Welt ins Gespräch bringen. Bald zum Anklicken bereit

Kirchenmusiker*in
Ein Beitrag zur Stärkung der Gemeinschaft und Einheit in der Kirche

Verwaltung/IT
Problemlösung und Entscheidungsfindung auf Basis von Daten und Fakten
Bibliothek des Theologischen Seminars der EKHNh

Herborns Bibliothek bietet einen Online-Katalog samt App. Hier kannst du extern im Bestand stöbern, Merklisten anlegen, dein Bibliothekskonto verwalten und auch von einem wachsenden E-Book-Bestand für dein Vikariat profitieren.